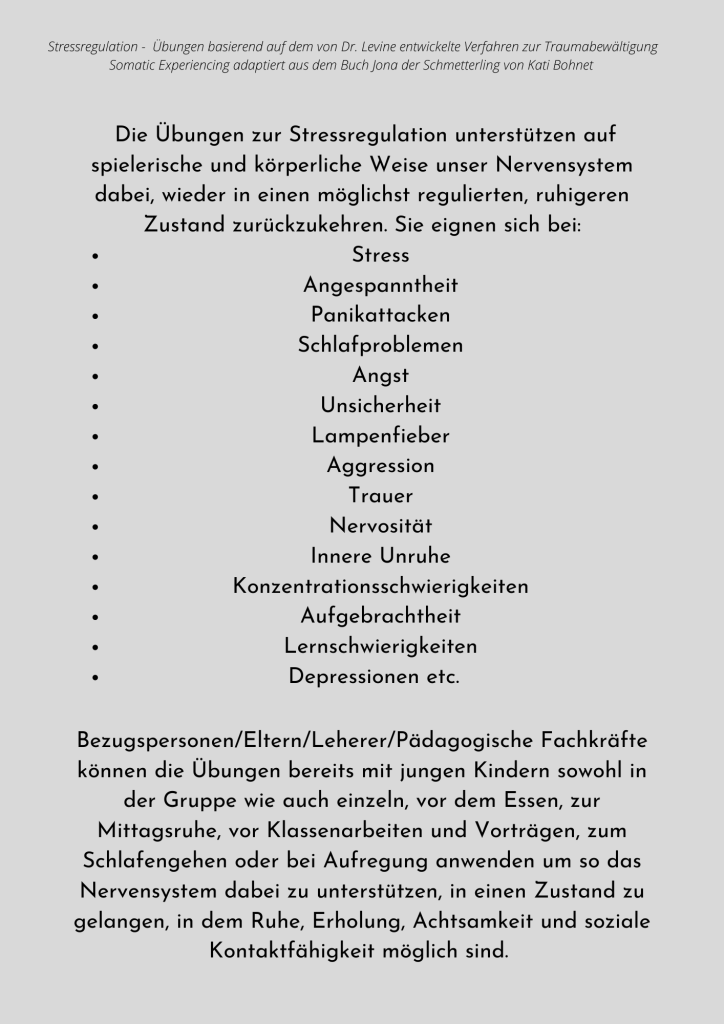Lisa Werthmüller
Dipl. Psychologische Beraterin – traumasensible Familienbegleitung. Für eine kindgerechte Entwicklung – damit Kinder und Jugendliche emotional satt sind und in der Folge im Erwachsenenalter psychisch gesund.
15. Mai 2025 auf LinkedIn
Viele pädagogische Institutionen schreiben sich Werte wie Achtsamkeit, Vertrauen und Wertschätzung auf die Fahne – und arbeiten gleichzeitig mit Sanktionen, rigiden Regelwerken und strenger Kontrolle. Wie passt das zusammen?
In meinem aktuellen Artikel beschreibe ich den Spannungsbogen zwischen formulierten Idealen und gelebter Realität – und warum Beziehung, Selbstreflexion und gelebte Werte keine Option, sondern Voraussetzung für Entwicklung sind.
Werte in pädagogischen Institutionen können – richtig verstanden – eine tragende Grundlage für gemeinsames Handeln und Zusammenleben sein. Sie geben Orientierung, stiften Identität und schaffen einen inneren Bezugsrahmen, der uns erinnert, wofür wir als Menschen und als Institution stehen. Sie formulieren ein Ideal und können ein Korrektiv sein inmitten von Alltag, Routinen und Strukturen. Doch Werte entfalten ihre Wirkung nur, wenn sie verkörpert, gelebt und in Beziehungen erlebbar gemacht werden.
Was geschieht, wenn Anspruch und Alltag auseinanderfallen?
Wenn eine Institution sich auf Werte wie Wertschätzung, Achtsamkeit, Respekt, Vertrauen, Vergebung oder Nächstenliebe beruft, gleichzeitig aber auf Strukturen von Reglementierung, Disziplinierung und Kontrolle zurückgreift, entsteht ein Spannungsverhältnis.
Ein Regelkatalog, der Regelbrüche automatisch sanktioniert, verschiebt den Fokus: Erwachsene übernehmen nicht mehr die Rolle der zugewandten Beziehungsperson, sondern agieren als Kontrollinstanz und Richter. Damit wird das Vertrauen im Voraus durch institutionelle Machtausübung ersetzt – an die Stelle von Beziehung tritt Bewertung.
Vertrauen entsteht nicht durch Kontrolle
Vertrauen lässt sich nicht durch Kontrollmechanismen erzeugen – im Gegenteil. Sie vermitteln dem Kind: Ich traue dir nicht – deshalb muss ich dich kontrollieren. Respektvolle Beziehungen entstehen nicht durch Sanktionen, sondern durch Zuwendung, Verständnis und emotionale Sicherheit. Strafen wirken beschämend und verletzend. Sie zerstören Mitgefühl – sowohl für andere als auch für sich selbst.
Langfristig können sie die Fähigkeit zur Empathie einschränken, Ärger und Wut verstärken und die emotionale Entwicklung hemmen. Die Botschaft lautet dann: Ich bin mehr wert als du, denn ich habe die Macht. Und: Du bist nicht okay, so wie du bist.
Die Gefahr von pädagogischer Form ohne Haltung
Wenn wir ausschließlich Konventionen und Normverhalten vermitteln – etwa über Hausordnungen oder Verhaltenserwartungen – und den eigentlichen emotionalen Gehalt ausblenden, vermitteln wir keine Werte, sondern Anpassung.
Echte Wertschätzung zeigt sich nicht im Einfordern von Regeln, sondern in der Art und Weise, wie wir auf deren Bruch reagieren. Kommt ein Kind zu spät zum Essen, können wir mit Sanktion antworten – oder mit Interesse: Was war los? Was hat dazu geführt? Wie können wir es gemeinsam anders gestalten?
Vom Verhalten zum Gefühl – Perspektivwechsel wagen
Es braucht die Bereitschaft, nicht von institutionellen Erwartungen aus zu reagieren, sondern vom Menschen her zu denken: Geht es wirklich um das Kind – oder um ein Verhalten, das wir als „richtig“ empfinden? Ein klassisches Regelwerk signalisiert oft: Du bist okay, solange du dich anpasst. Bedürfnisse und Gefühle fallen durchs Raster.
Ein liebevoller, gewaltfreier Umgang – geprägt von Achtsamkeit und Beziehung – stärkt hingegen das Selbstwertgefühl. Kinder, die lernen, dass sie Nein sagen dürfen, dass ihre Gefühle zählen und sie in ihrer Not begleitet werden, entwickeln Schutzkompetenz, Selbstwirksamkeit und Beziehungsfähigkeit.
Anpassung ist kein Zeichen von Entwicklung
Der äussere Erfolg von Sanktionen ist oft trügerisch. Kinder passen sich an, weil sie keine Wahl haben – nicht, weil sie verstanden haben. Nur weil ein Kind ruhig ist, heisst das nicht, dass es innerlich zur Ruhe gekommen ist. Oft sind seine Bedürfnisse weiterhin unerfüllt – und es hat gelernt: Ich darf mich nicht zeigen.
Viele Erwachsene kennen diesen Mechanismus aus ihrer eigenen Biografie: Ich werde nur geliebt, wenn ich funktioniere.Daraus entstehen Glaubenssätze wie: Ich darf nicht Nein sagen. Ich muss es allen recht machen. Diese Erfahrungen prägen bis ins Erwachsenenleben hinein.
Was Kinder brauchen – und was wir als Fachpersonen entwickeln können
Wirklich gelebte Werte entstehen, wenn wir uns dafür interessieren, was hinter dem Verhalten steckt. Wenn wir mit Kindern in Beziehung bleiben – gerade dann, wenn es schwierig wird. Wenn wir uns fragen:
- Was braucht dieses Kind jetzt wirklich?
- Was ist der emotionale Ursprung seines Verhaltens?
- Was macht sein Verhalten mit mir – und warum?
So entsteht ein Raum, in dem sich Beziehung entwickeln kann – jenseits von Bewertung.
Einladen statt kontrollieren – Beziehung gestalten
Diese Wege sind nicht immer einfach. Sie fordern uns als Fachpersonen heraus, sie brauchen Mut, Geduld, Selbstreflexion und die Bereitschaft, eigene Muster zu hinterfragen. Aber sie sind – aus bindungsorientierter Sicht – der nachhaltigste Weg für gesunde Entwicklung.
Wenn wir Kinder und Jugendliche wirklich begleiten wollen, brauchen wir eine Pädagogik, die sich nicht auf Form, sondern auf Haltung stützt.
Werte leben heisst, sich in Beziehung zu zeigen.
- Verantwortung statt Bewertung
Wir nutzen unsere elterliche oder pädagogische Autorität nicht aus, sondern gehen verantwortungsvoll damit um. Wir übernehmen die Verantwortung für die Qualität der Beziehung zu unseren Kindern und bieten durch unsere Führung Orientierung, um ihr Grundbedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen.
- Achtsamkeit statt Strafe
Statt das Verhalten ändern zu wollen, nehmen wir es als wichtiges Signal und erkennen die dahinterliegenden Gefühle und Bedürfnisse. Wir fühlen uns ein, begegnen unseren Kindern empathisch und bleiben authentisch in unserer Rolle als Bezugspersonen.
- Wertschätzung statt Abwertung
Unser Kind ist ein kleiner, aber gleichwertiger Mensch, den wir wertschätzend behandeln. Wir positionieren uns klar, achten unsere eigenen Grenzen und respektieren die unseres Kindes. Bewusst vermeiden wir es, diese absichtlich zu übertreten.
- Vertrauen statt Kontrolle
Wir vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten als Eltern oder Bezugspersonen sowie in die Entwicklungskompetenz unseres Kindes. Wir lassen es eigene Erfahrungen machen, schaffen sichere Räume für diese Erfahrungen und begleiten es unterstützend, statt es zu bevormunden oder durch Kontrolle einzuschränken.
- Miteinander statt Gegeneinander
Kinder sind von Natur aus kooperativ und arbeiten mit uns im Alltag zusammen. Gemeinsame Tätigkeiten fördern die Verbindung. Gleichzeitig braucht das Kind Räume für Autonomie und Selbstständigkeit. In Konflikten vermeiden wir Machtkämpfe, ohne dabei Konflikte zu unterdrücken. Stattdessen suchen wir immer wieder Möglichkeiten, in Verbindung zu bleiben und ein lebendiges Miteinander zu gestalten.
- Dialog statt Monolog
Wir haben echtes Interesse an der Sichtweise unseres Kindes und gehen offen und unvoreingenommen in Gespräche. Wir hören bewusst zu, nehmen es ernst und versuchen, seine Perspektive nachzuvollziehen – auch wenn wir uns nicht immer einig sind. Ein wertschätzender Dialog fördert gegenseitiges Verständnis und Verbundenheit.
- Gleichwürdige Beziehung statt belasteter Struktur
Durch diese Werte gelingt eine konstruktive, respektvolle und liebevolle Beziehung voller Vertrauen und tiefer Verbundenheit. Statt das Kind zu erziehen, begleiten wir es und ermöglichen ihm, sich in einem sicheren, wertschätzenden Umfeld zu entfalten.